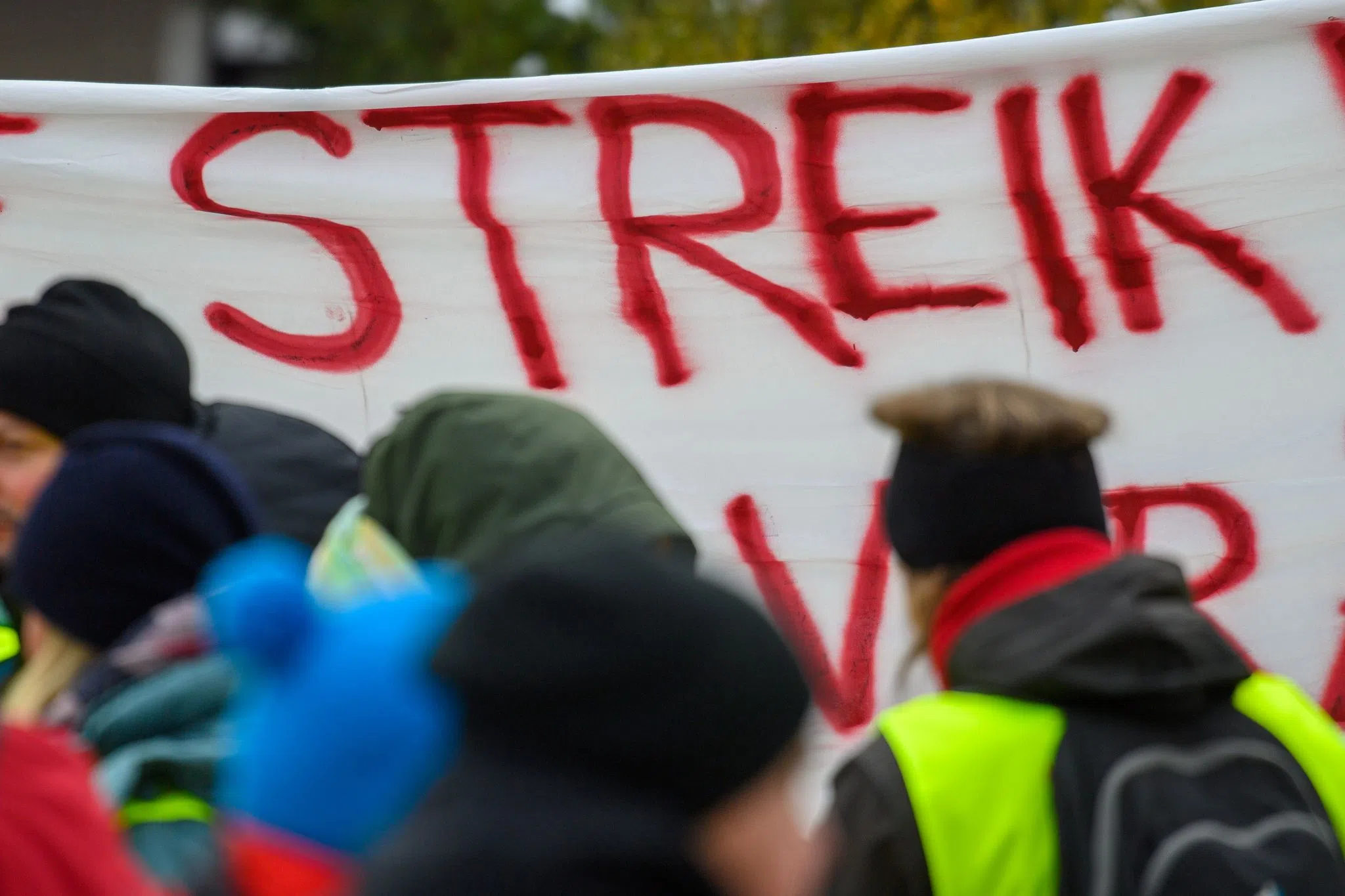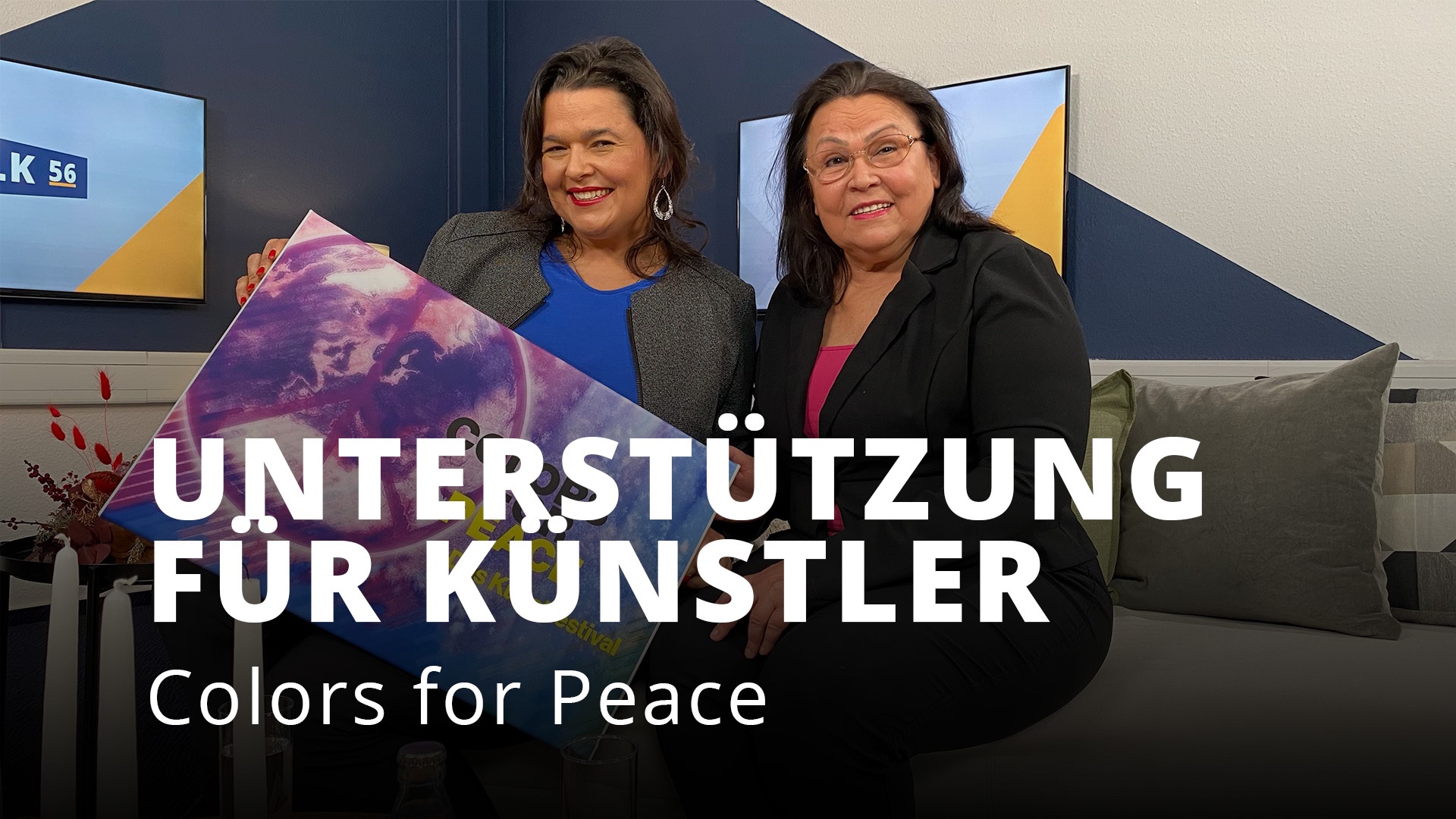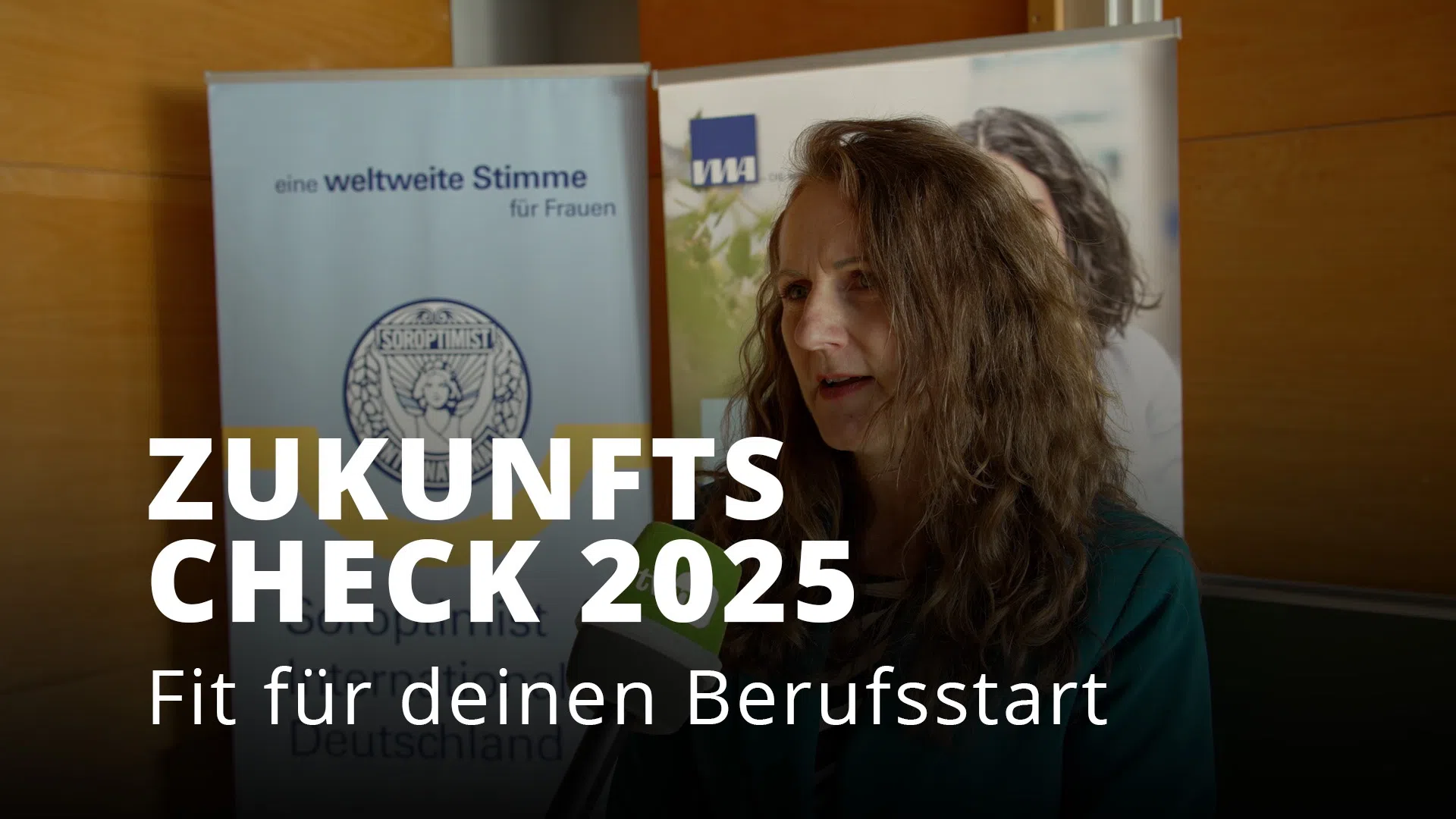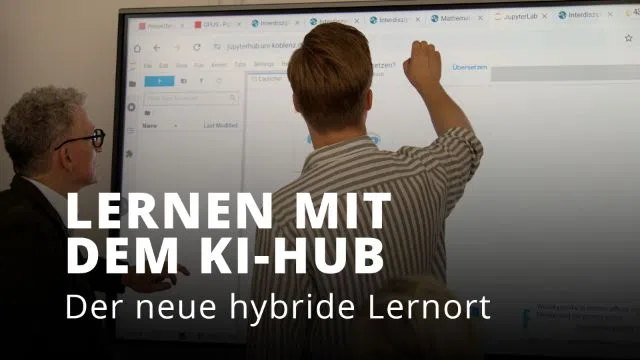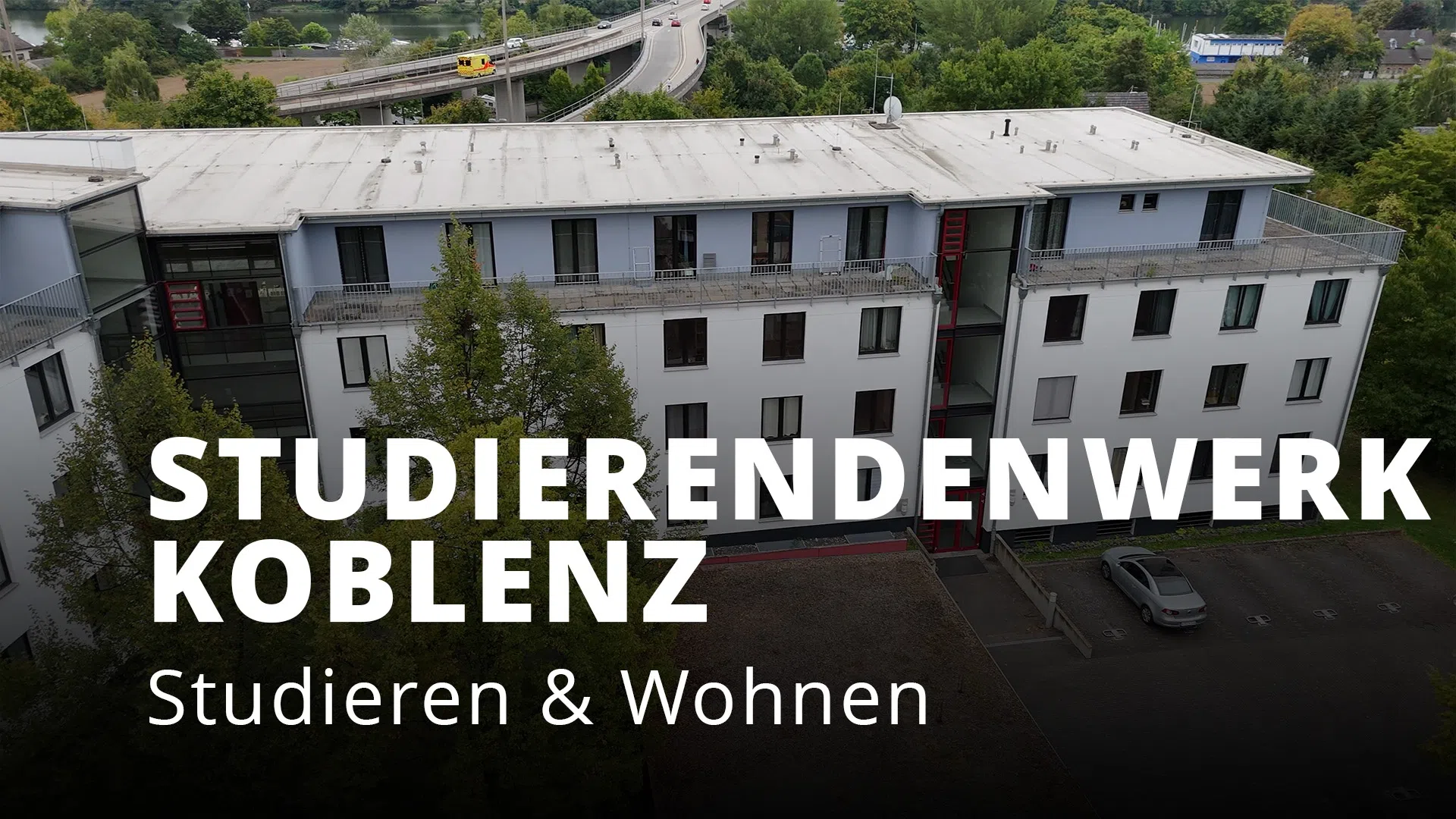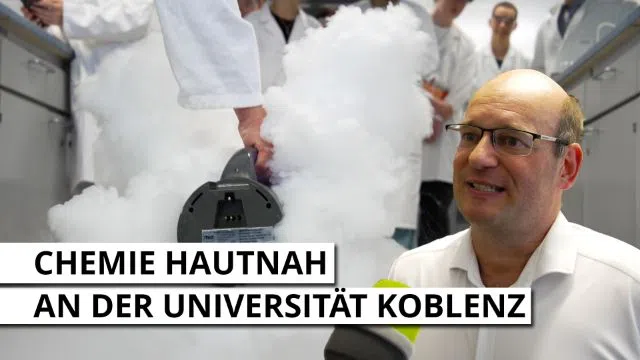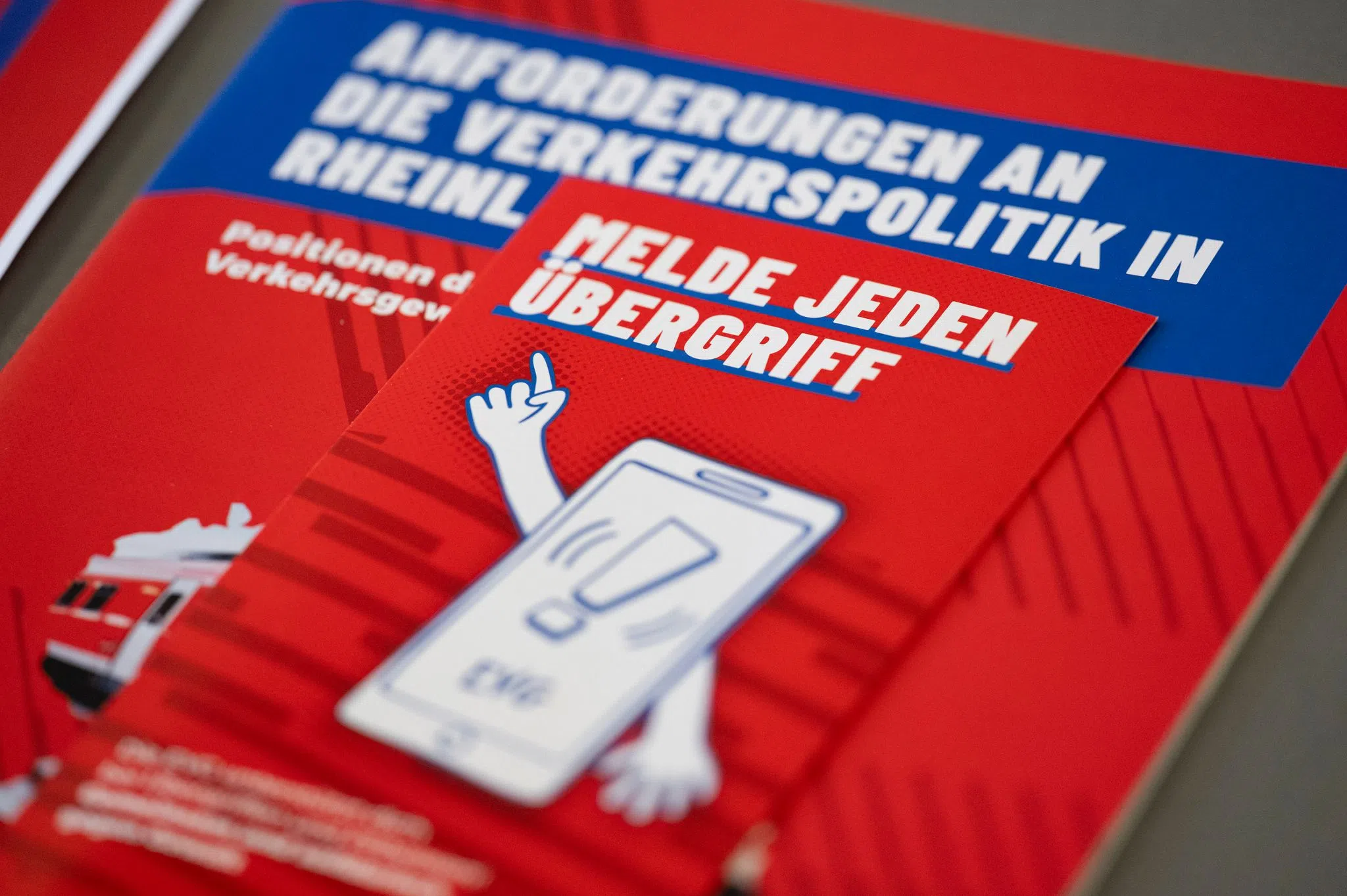Rüstung als Chance für Autobranche - aber kein Allheilmittel
Milliarden fließen in den kommenden Jahren in die Verteidigung. Können sie auch der kriselnden Autoindustrie helfen? Warum der Weg in den Markt für Rüstungsgüter nicht ganz einfach ist.
Mainz/Berlin (dpa/lrs) -
Schrumpfender Absatz, sinkende Erlöse selbst bei den Branchenriesen - die deutsche Automobilindustrie steckt in einer tiefen Krise, und mit ihr die vielen Zulieferer, von denen es in Rheinland-Pfalz zahlreiche gibt. Das Geschäft mit Rüstungsgütern dagegen brummt angesichts der immens gestiegenen Investitionen in die Verteidigung. Steckt hier die große Chance für so manches Unternehmen zwischen Westerwald und Südpfalz?
Die Gründe für den Abschwung sind vielfältig, reichen von US-Zöllen bis hin zu Absatzproblemen im wichtigen chinesischen Markt. Einige Beispiele: Bei BMW brach der Gewinn im ersten Halbjahr 2025 um mehr als ein Viertel ein, bei VW um mehr als ein Drittel, bei Mercedes-Benz um mehr als die Hälfte.
VDA warnt vor überhöhten Hoffnungen
In der Folge bleiben bei Zulieferern Aufträge aus, dazu kommen Kosten für den Wandel hin zum Elektromotor. ZF etwa streicht Tausende Stellen, auch in Saarbrücken. Auch andere Zulieferer wie Bosch oder Continental mit Standorten in der Region wollen Jobs abbauen. Können die gebeutelten Unternehmen Auftragsbücher füllen und Jobs erhalten, wenn sie in den Markt für Rüstungs- oder Dual-Use-Güter einsteigen, also für Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können?
Der Verband der Automobilhersteller (VDA) ist eher skeptisch. Die wachsende Nachfrage aus dem Bereich Dual Use und Rüstung sei für Unternehmen mit ihrem Know-how natürlich eine Option, sagt ein Sprecher. «Gleichzeitig werden sich die öffentlich debattierten Erwartungen an die Schaffung von alternativen Arbeitsplätzen aber mit hoher Wahrscheinlichkeit als überhöht herausstellen.»
Unternehmerverband: Passt nicht zu jedem Geschäftsmodell
Ähnlich klingt das beim Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz, Karsten Tacke. Dual-Use- und rüstungsnahe Technologien könnten der Auto- und Zulieferindustrie zusätzliche Märkte erschließen, seien aber kein Allheilmittel und passten nicht zu jedem Geschäftsmodell. «Am Ende zählt die unternehmerische Entscheidung jedes Betriebs – selbstverständlich im Rahmen von Exportkontrollen und Compliance.»

Dual-Use und rüstungsnahe Technologien könnten der Auto- und Zulieferindustrie zusätzliche Märkte erschließen, sagt Karsten Tacke von der Landesvereinigung Unternehmerverbände. Aber sie seien kein Allheilmittel und passten nicht zu jedem Geschäftsmodell. (Archivbild) | Jörg Halisch/dpa
Für den VDA steht fest: «Die möglichen neuen Arbeitsplätze werden keinesfalls die durch die Transformation und die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit des Standorts gefährdeten Arbeitsplätze ersetzen können.» Außerdem seien die Anforderungen an eine solche neue Ausrichtung sehr komplex, eine einfache Umstellung von Kapazitäten sei nicht machbar.
Experte sieht Potenzial vor allem im Nutzfahrzeugsektor
Wie Branchenexperten sagen, geht es um andere Sicherheitsanforderungen an die Produktion. Zertifizierungs-, Prüf- oder Normierungsverfahren sind in der Wehrtechnik ganz anders als im Pkw- und im zivilen Nutzfahrzeugsektor.
Ein Fachmann für Nutzfahrzeuge ist Martin Thul vom Commercial Vehicle Cluster Südwest in Kaiserslautern, ein Netzwerk von in der Branche tätigen Akteuren. Er sieht für Unternehmen aus diesem Bereich einen wesentlich kürzeren Weg hin zu Dual-Use- oder Rüstungsgütern als im Pkw-Segment. Pkw seien ein Konsumgut, stünden die meiste Zeit herum. Nutzfahrzeuge seien intensiv im Einsatz, würden stark beansprucht - Dinge, die zu einer militärischen Nutzung passen. Ein Lkw diene dem Transport, sei es von Menschen oder Gütern - letztere könnten Nahrungsmittel oder Granaten sein.
Langwierige Prozesse, hohe Sicherheitsanforderungen
Doch auch Thul verweist auf hohe Sicherheitsanforderungen im militärischen Bereich, auch müssten für die Teilnahme an Förderprogrammen viele Auflagen beachtet werden. Im Rüstungssektor könnten von der Antragstellung für ein Projekt bis zu dessen Start gut und gerne zwei Jahre vergehen, sagt Thul. Im zivilen Bereich sei ein Projekt dann häufig fast schon vor dem Abschluss.
Hinzu komme, dass es für alle möglichen Komponenten immens hohe Anforderungen gebe und Firmen lange Service- und Instandsetzungszeiten garantieren sowie Ersatzteile lange vorhalten müssten. Es sei klüger, Produkte erst für eine zivile Nutzung zu entwickeln und sie gegebenenfalls an den militärischen Bereich anzupassen.
Deutschland und Rheinland-Pfalz haben einen Standortvorteil
«Krieg funktioniert heute anders als früher», sagt Thul. Um dafür gewappnet zu sein und passende Innovationen zu entwickeln, müsse branchenübergreifend gedacht werden, in Systemen, nicht einzelnen Komponenten, sagt Thul. «Projektverbünde sind eine Chance für die Fahrzeugindustrie», betont er. Es brauche Zulieferer, die chemische Industrie, IT- und Software-Lösungen, ein großes Paket. «Da haben wir in Deutschland einen Standortvorteil.» Denn hierzulande sei das Spektrum spezialisierter Unternehmen groß.
Das trifft auch auf Rheinland-Pfalz zu, genannt seien etwa Daimler Truck mit seinem Werk in Wörth, John Deere in Kaiserslautern, der Baumaschinenhersteller Volvo in Konz oder die General Dynamics European Land Systems-Bridge Systems GmbH in Kaiserslautern, die unter anderem militärische Brückensysteme herstellt. Und das in Nachbarschaft zum Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) oder dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE).

Auch Daimler Truck mit seinem großen Werk in Wörth setzt auf Partnerschaften und verspricht sich mehr Geschäft mit militärischen Lkw. (Archivbild) | Uli Deck/dpa
Daimler Truck senkte zwar kürzlich seinen Ausblick, verspricht sich aber in Zukunft mehr Geschäft mit militärischen Lkw. 2024 machte der Umsatz damit wie in den Vorjahren rund ein Prozent des gesamten Umsatzes aus. «Vor dem Hintergrund der aktuellen verteidigungspolitischen Herausforderungen erwarten wir, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren steigen wird und wir das Geschäft im Defence Bereich perspektivisch ausbauen werden», heißt es. Der Defence-basierte Umsatz soll bis 2030 verdoppelt werden.
Partnerschaften auch bei Daimler Truck im Fokus
Daimler Truck setzt seinerseits verstärkt auf Partnerschaften, beispielsweise mit ARX Robotics oder Arquus. ARX Robotics ist ein Spezialist für unbemannte autonome Landsysteme in München. Hier geht es um Integration von Robotik- und KI-Technologien in Fahrzeugplattformen von Daimler Truck. Bei der Kooperation mit dem französischen Militärfahrzeughersteller Arquus ist ein Ziel, gemeinsam militärische Radfahrzeuge zu entwickeln.
dpa
Bild: Milliarden werden in die Rüstung gesteckt - birgt das Chancen für die gebeutelte Autobranche? (Symbolbild) | MSgt Sean M. Worrell/US Air Force/dpa
Alle Meldungen, aktuell und regional aus Koblenz und dem Mittelrhein-Gebiet auf tv-mittelrhein.de