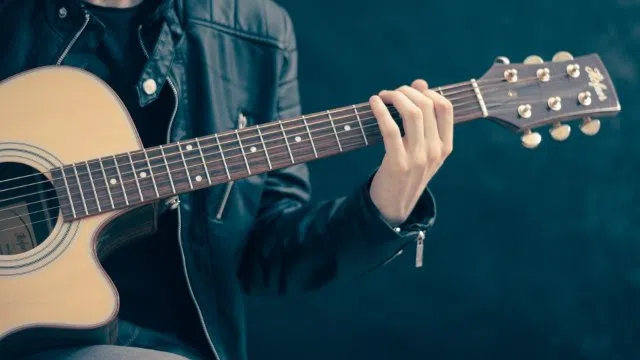Jeder fünfte Baum in Rheinland-Pfalz ohne Schäden
Neue Bäume wegen Klimawandel - Der Wald braucht Alternativen
Gensingen/Börrstadt (dpa/lrs) - Anhaltende Hitze und Trockenheit setzen den Wäldern in Rheinland-Pfalz immer mehr zu. Da viele heimische Baumarten wie die Buche und die Eiche zunehmend schlechter mit den Folgen des Klimawandels klarkommen, ist die Suche nach Alternativen in vollem Gange. «Wir brauchen Artenreichtum, um eine gute Waldstruktur zu haben», sagt der Leiter des Forstreviers Dannenfels, Martin Teuber, der Deutschen Presse-Agentur. «Wo die natürliche Verjüngung des Waldes - die natürlich Priorität hat - nicht klappt, helfen wir nach.»
Das Revier des 57-Jährigen im Donnersbergkreis hat schwierige Bedingungen teils mit Hängen, steinigem und sandigem Grund. Etliche Buchen sind bereits in den Kronen braun oder abgestorben, auch viele Eichen weisen deutliche Schäden auf. Die bereits seit mehreren Jahren extrem heißen Sommer schwächen die Bäume nachhaltig. Das führe dazu, dass diese auch weniger Kraft haben, sich gegen Schädlinge wie den Eichenprachtkäfer oder Pilze wie das Weiße Stängelbecherchen bei der Esche und die Rußrindenkrankheit beim Ahorn zu wappnen, erklärt der Revierförster.
«Wir merken, dass unser heimisches Baumartenspektrum immer mehr Probleme bekommt, deswegen müssen wir etwas tun und uns Alternativen holen», betont Teuber, der seit zwölf Jahren das Revier mit einer Fläche von 2200 Hektar und rund 30 verschiedene Baumarten leitet. Bei der Suche nach neuen Baumarten, die mehr Hitze und Trockenheit vertragen, dürfe aber nicht nur an Pflanzen aus dem Mittelmeerraum gedacht werden. «Im Winter haben wir hier Minusgrade, das darf nicht vergessen werden.»
Seit einiger Zeit laufen im Forstrevier Dannenfels daher Versuche mit neu gesäten und gepflanzten Baumarten wie Mehlbeere, Eberesche, Sommerlinde, Speierling, Wildbirne und -apfel, Eisbeere und dem Französischen Ahorn. In einem extra abgezäunten Bereich auf mehreren Hektar, um die kleinen Pflanzen und ihre Triebe vor den Wildtieren zu schützen, versuchen die Experten so, einen möglichst großen Artenreichtum auch mit nicht klassischen Baumarten anzusiedeln. Es werden auch außerhalb der Umzäunung Wuchshüllen als Wildverbissschutz um die kleinen neuen Bäume gestellt, um die Vielfalt der Baumarten zu erhalten.
Als besonders vielversprechend bei den Versuchen entwickelten sich die Mehlbeere und der Französische Ahorn, berichtet der Revierförster. «Das kostet aber alles extrem viel Zeit und Arbeit.» Etwa fünf Jahre dauere es etwa, bis die Pflanzen rund 1,50 Meter hoch sind. Wichtig sei in der Zeit auch eine intensive Bejagung gerade des Rehwilds. Die Tiere fräßen besonders gerne die nährstoffhaltigsten Triebe. «Die suchen sich gerne das Beste raus.» Gerade die Winterzeit sei deshalb sensibel, weil den Tieren dann Futteralternativen fehlten. Gesät und gepflanzt werde wegen der Feuchtigkeit des Bodens in der Regel im Herbst.
Die wichtige Unterstützung der Jäger bei der Wiederaufforstung der Wälder unterstreicht auch Wildmeister Christoph Hildebrandt vom Landesjagdverband Rheinland-Pfalz mit seinen rund 20 000 Mitgliedern. «Die Jäger sichern den jungen Baumbestand, mit zwei aufeinander abgestimmten Methoden.» Sobald die Jagdzeit beginne, bejagten die Jäger die neu zu begründenden Waldgebiete intensiv.
«Ich muss dort löschen, wo es brennt», betont Hildebrandt mit Blick auf die Nahrungsgewohnheiten der Tiere. Besonders das wiederkäuende Schalenwild soll so von den Flächen für die Wiederaufforstung vertrieben werden. Neben dem Rehwild zählen etwa auch das Rot- und Muffelwild dazu. Bis die Bäume etwa 1,5 Meter hoch sind, werde die intensive Jagd durchgeführt. Die Tiere folgten nur ihrem natürlichen Nahrungsverhalten, betont der langjährige Experte.
Es müsse aber auch eine Alternative für die Wildtiere geben, damit diese Nahrung aufnehmen könnten. Daher legen die Jäger nach Angaben von Hildebrandt wildgerechte Waldwiesen an, wo das Wild in Ruhe fressen kann. «Das muss in der Planung der Wiederaufforstung in den Wäldern mitberücksichtigt werden.» Waldbesitzer und Jäger müssten gemeinsam sowohl für wild- als auch einen waldgerechten Zustand sorgen.
«Es reicht aber auch mal aus, dass ein Jäger einfach nur auf dem Hochsitz sitzt und dort seinen Geruch verbreitet», berichtet Hildebrandt, der auch Leiter der Landesjagdschule des Verbands mit Sitz in Gensingen ist. «Der verbreitet für die Tiere ein Vergrämungsgefühl.» Die Rehe fühlten sich dann in ihrem natürlichen Nahrungsgebiet gestört und zögen weiter. Zu den Aufgaben des Landesjagdverbands gehört auch der Natur- und Umweltschutz.
Rheinland-Pfalz zählt mit über 42 Prozent Waldanteil zu den waldreichsten Bundesländern. Das entspricht einer Fläche von rund 840 000 Hektar. Der Laubbaumanteil liegt in den Wäldern im Land bei fast 60 Prozent, der Nadelbaumanteil bei knapp 40 Prozent. Insgesamt sind 50 Baumarten in Rheinland-Pfalz heimisch. Die Buche ist nach Angaben des Landesbetriebs Landesforsten die am häufigsten vorkommende Baumart im Land, gefolgt von Eiche und Fichte.
Nach dem Waldzustandsbericht des Jahres 2022 beträgt der Anteil geschädigter Bäume in den rheinland-pfälzischen Wäldern 81 Prozent. «Der Wald ist klimakrank», hatte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) bei der Präsentation des Berichts erklärt. Die größten Probleme wiesen Buche, Eiche, Esche und Fichte auf.
In Rheinland-Pfalz gibt es 44 staatliche Forstämter und 324 staatliche Forstreviere. Ihre Aufgabe ist es, den Wald zu schützen und zu pflegen. Der Wald in Rheinland-Pfalz ist mit einem Anteil von rund 46 Prozent überwiegend in kommunaler Hand. Dazu kommen der Privat- und Staatswald sowie zu einem sehr geringen Anteil Staatswald des Bundes.
Foto: Uwe Anspach/dpa
Berichterstattung regional und aktuell aus Koblenz und der Region Mittelrhein.